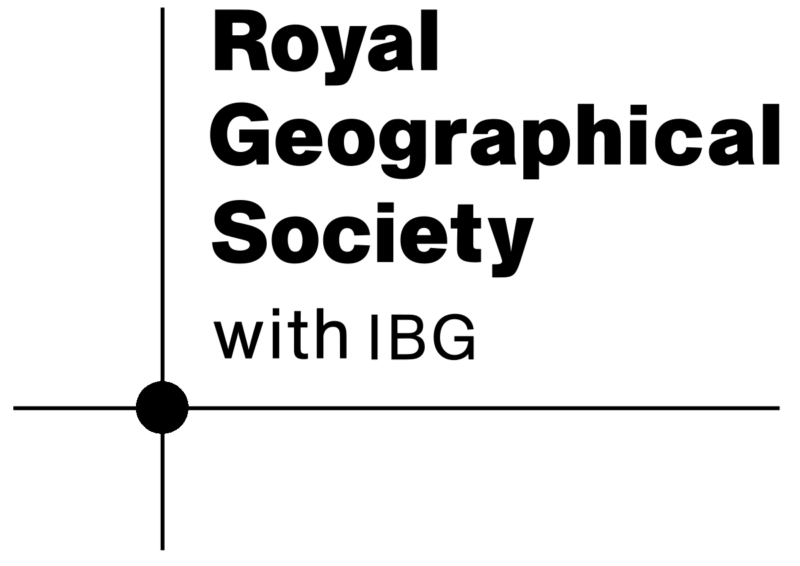NAHSICHT DSCHUNGEL EINE LIEBESERKLÄRUNG
Wüsten, Dschungel, Hochgebirge, Steppen und Savannen – in den Wildnisgebiete der Erde fühle ich mich in meinem Element. Wochenlang in den von menschlicher Zivilisation unberührten Naturregionen unserer Welt herumzustreifen, sorgt für ein grandioses Hochgefühl. Doch mein Herz schlägt eindeutig für den Dschungel, die „grüne Hölle“. In den endlosen, unerschlossenen und weitgehend unerforschten Wäldern Amazoniens, Zentralafrikas oder Ozeaniens fühle ich mich auf meinen Reisen stets am wohlsten.

Ein Buch des britischen Autors Rudyard Kipling hat nicht nur meine Liebe zum Dschungel schon zu Kinderzeiten entfacht. „Das Dschungelbuch“, der erste Band erschien bereits 1894, erzählt die Geschichte des Waisenjungen Mowgli und seiner Bewusstwerdung vom verspielten Kind bis hin zum Herrn über die Tierwelt. Er muss lernen, wie hart die Gesetze der Natur sind und welch hohes Maß von Verantwortung, Willen und Anpassungsfähigkeit sie ihm abfordern. Er muss sich behaupten im ständigen Überlebenskampf gegen wilde Tiere wie den Tiger Shir Khan oder der Riesenschlange Kaa. Das Buch avancierte zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Jugendbücher der Welt und hat maßgeblich zur romantisch verklärten Vorstellung des Dschungels voller exotischer Tiere beigetragen, die man als Freunde fürs Leben gewinnt, wie dem schwarzen Panther Bagheera oder dem gemütlich Bär Balu.

Ursprünglich bezeichnet das Wort „Jangal“ auf Persisch „Dickicht“. Die in Indien lebenden Briten leiteten daraus das englische Wort „Jungle“ ab und bezeichneten damit vorwiegend den tropischen Monsun-Regenwald und die bambusreichen Sumpfgebiete des indischen Subkontinents. Als Synonym für Urwald, dichtwachsende Wälder mit undurchdringlicher Vegetation und extrem dichten Unterholz hat der Dschungel in unserem Wortschatz Einzug gehalten. Für mich bedeutet Dschungel einfach nur Abenteuer-Garantie.

In den tropischen Regenwäldern trifft man auf die weltweit größte biologische Vielfalt, doch wie hoch die Artendichte wirklich ist, weiß niemand. Dieses Rätsel trägt zum faszinierenden Mysterium des Dschungels bei. Forscher schätzen, dass dort über 90 % aller terrestrisch bekannten Arten beheimatet sind, und das, obwohl die Regenwälder nur etwa 7 % der Landmasse der Erde einnehmen. Für einen Besucher im Regenwald sieht die Realität allerdings ernüchternd aus. Wer im Regenwald unterwegs ist, kann von der Artenvielfalt bis auf dauerhaften Hautkontakt mit Rieseninsekten kaum etwas wahrnehmen. Aber er wird mit einer Fülle anderer Sinneseindrücke nicht nur entschädigt, sondern überwältigt.

Sobald man ein Dorf verlässt und von der Lichtung das Tor zum Dschungel durchschreitet, betritt man eine andere Welt. Kein Baum gleicht dem anderen, jedes Blatt ist einzigartig und jede Pflanze hat ihren ganz eigenen Grünton. Das Farbenspiel ist überwältigend, einfach irre! Doch der in permanentes, grünes Zwielicht gehüllte, sagenumwobene Urwald mit seinen ungeheuren Ausmaßen erscheint vielen Besuchern als feindlich und gefährlich. Dann wird der dichte, dunkle und feuchte Wald, dem man nicht entrinnen kann, zum Synonym des Unbekannten, mit eigenen Regeln, denen man sich unterwerfen muss.

Der Dschungel ist erbarmungslos, ein übermächtiger Feind, der dich mit Haut und Haaren verschlingen kann. Die Haut quillt auf, wird empfindlich gegen Infektionen, Keime und eindringende Mikroorganismen. Kleinste Verletzungen durch spitze Dornen, zurückschnellende Ranken, scharfe Gräser und schroffe Felsen setzen dem Körper permanent zu. Dazu die ewigen Plagen durch aggressive Ameisenbisse, Fliegenattacken, Blutegelüberfälle und Insektenbisse. Für die meisten Menschen aus unserem Kulturkreis ein einziges Horrorszenario, für mich ein Risiko, das ich billigend in Kauf nehme, trotz der Malaria, die mir seit über dreissig Jahren durch üble Fieberschübe in regelmäßigen Abständen zu schaffen macht.

Wer den Dschungel überleben will, muss selbst zum Dschungel werden. Man muss ihn annehmen, verinnerlichen, ihn verstehen, von ihm lernen, doch dagegen anzukämpfen, ist hoffnungslos. Wer das versucht, hat schon verloren. Wochenlang in endlosen Wäldern unterwegs zu sein, fordert demütigen Respekt vor der Natur. Man muss viel Lehrgeld zahlen, Verluste ertragen, Niederlagen akzeptieren und man lernt seine eigenen physischen und psychischen Grenzen gnadenlos kennen. Der Preis ist hoch, doch erst dann erfolgt der wahre Genuss.

Die Sinne werden geschärft, die Poren öffnen sich, man kann die feuchtwarme Luft mit dem erdigen Geruch förmlich einsaugen. Hitze und Feuchtigkeit sind im Dschungel meine wohl gelittenen Dauerbegleiter. Ich bin von morgens bis abends nass von Kopf bis Fuß – vom Regen, von den durchnässten Pflanzen, von Flussdurchquerungen und vom Schweiss. Nicht zu vergessen, den warmen Modder des Untergrundes, der alles durchdringt und nicht nur von der Kleidung Besitz ergreift. Ich habe manchmal das Gefühl, mit dem Urwald zu verschmelzen. Man wird unglaublich empfindsam für diese überaus intensive Körpererfahrung, die ich trotz aller Belastungen nicht missen möchte.

Sprechen wir noch über die einzigartige Melodie des Dschungels. Wenn der Mensch am Abend Ruhe und Stille sucht, um sich von den Strapazen des Tages zu erholen, erwacht der Dschungel nachts zum Leben. Der Wald ist erfüllt von dem vielstimmigen Konzert der Vögel, dem Quaken der Frösche, den Schreien der Brüllaffen und einem undefinierbaren Flüstern, Zirpen und Kreischen von fremdartigen Tieren, die auf nächtlichen Beutezug gehen. In den ersten Jahren wurde die geheimnisvolle Geräuschkulisse schnell unheimlich und die geschundene Fantasie wurde überstrapaziert. Die absolute Dunkelheit weckte seltsame Ängste und das Einschlafen war in so einer lebensfeindlichen Umgebung sehr gewöhnungsbedürftig.

Mit den Jahren hat sich mein Verhältnis zum Dschungel gewandelt. Heute liebe ich es, gemütlich im Zelt zu liegen und einfach nur zu lauschen. Immer noch sind meine Sinne bis zum Bersten gespannt und jedes Geräusch bekommt eine fast übermächtige Bedeutung. Wenn dann die dicken Regentropfen auf dem Weg durch das Laubwerk der Baumriesen auf mein Zeltdach prasseln, fühle ich mich sicher und geborgen. Ein unbeschreibliches Gefühl, das mich glücklich macht.

Der international führende Evolutionsforscher Edward O. Wilson, auch bekannt als „Vater der Biodiversität“, beginnt sein Buch über den Wert der Vielfalt mit der eindrucksvollen Beschreibung einer Nacht im Amazonas-Regenwald: „Tief im Herzen hoffen wir, dass wir niemals alles entdecken werden. Wir beten, es möge immer eine Welt geben wie jene, an deren Rand ich in der Finsternis saß. Der Regenwald in seinem Reichtum ist eines der letzten irdischen Refugien dieses zeitlosen Traumes“. Für mich wird es Zeit, diesen Traum wieder Wirklichkeit werden zu lassen, die endlosen Wälder aus der Nähe zu betrachten, einzutauchen in das archaische Meer aus Grün und den Dschungel auf dem Körper und in meiner Seele zu spüren.